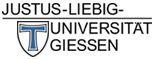Joint project
SPP 1580 TP - Intracellular compartments as places of pathogen-host-interactions - Teilprojekt: Exportierte P. falciparum Chaperone/Co-Chaperone: Relevanz für die intraerythrozytäre Lebensweise des Parasiten.
Funder: German Research Foundation
Period: 2011-2017
URI: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/198175986
Detailed description:
Mehr als 100 Jahre sind seit der Entdeckung von Mikroorganismen als Verursachern von Infektionskrankheiten vergangen. Dennoch sind wir weit davon entfernt, alle mikrobiellen Infektionskrankheiten wie Malaria oder Tuberkulose verhindern oder doch zumindest effizient behandeln zu können. Viele der mikrobiellen Infektionserreger haben gemeinsam, dass sie zur Krankheitsauslösung in eine Wirtszelle eindringen und sich dort vermehren müssen. Häufig wird sogar eine Fresszelle des Immunsystems infiziert, die eigentlich der Abwehr dient und die von den Pathogenen zum Lebensraum umprogrammiert wird. Dabei existiert das Pathogen in definierten membranumgebenen Räumen der Wirtszelle, den Zellkompartimenten. Die Erforschung dieser Kompartimente als Orte der Entscheidung zwischen Vermehrung oder Eliminierung des mikrobiellen Erregers steht im Mittelpunkt dieses Schwerpunktprogramms. Zentrale Fragestellungen sind: Wie sind die pathogenenthaltenden Kompartimente zusammengesetzt und welche physiologischen Bedingungen herrschen in ihnen? Welche pathogeneigenen und welche wirtsproduzierten Substanzen sind für die Einrichtung und Aufrechterhaltung dieser Kompartimente verantwortlich? Welche Substanzen des Erregers bzw. des Wirts werden auf welchem Weg aus dem Kompartiment heraus- oder in das Kompartiment hineintransportiert? Welche Wechselwirkungen gibt es mit anderen Kompartimenten der infizierten Zelle? Wie wird entschieden, welche Wirtszellvesikel mit einem pathogenenthaltenden Kompartiment interagieren und welche nicht? Wie schalten die Pathogene intrakompartimentelle Abwehrmechanismen des Wirts aus? In Deutschland gibt es eine hervorragende und traditionell vorwiegend biochemisch und genetisch ausgerichtete Mikrobiologie. Daneben hat sich eine starke Zellbiologie etabliert, die sowohl molekularbiologische Methoden als auch modernste bildgebende Verfahren benutzt, um zelluläre Vorgänge zu verstehen. Das Schwerpunktprogramm bringt diese bisher getrennten Disziplinen zur zellbiologischen Charakterisierung pathogenenthaltender Kompartimente zusammen. Dies wird zweifellos einen bleibenden Einfluss auf die Forschungslandschaft in diesen Bereichen haben und erlauben, eine internationale Vorreiterrolle in diesem Feld einzunehmen.
Teilprojekt:
In früheren Untersuchungen konnten wir Hsp40 Proteine (PfHsp40) identifizieren, die von P. falciparum synthetisiert und in die Wirtszelle exportiert werden. Im laufenden Projekt gelang uns die Identifizierung eines Hsp 70 Proteins (PfHsp70x), das ebenfalls exportiert wird und das ein Interaktionspartner der Hsp 40 Proteine fungieren könnte. Im Fortsetzungszeitraum möchten wir analysieren, ob diese beiden Proteine eine Rolle bei der Verteilung anderer Parasitenproteine in der infizierten Zelle haben. Als experimentelle Ansätze sind reverse Genetik und Komplementationsstudien beabsichtigt. Auch soll eine mögliche Interaktion des humanen Hsp 70 mit PfHsp40 untersucht werden. Sollte PfHsp70x eine für den Parasiten essentielle Funktion besitzen, wird das langfristige Ziel darin bestehen, diese Funktion durch Inhibitoren zu beeinträchtigen.
Mehr als 100 Jahre sind seit der Entdeckung von Mikroorganismen als Verursachern von Infektionskrankheiten vergangen. Dennoch sind wir weit davon entfernt, alle mikrobiellen Infektionskrankheiten wie Malaria oder Tuberkulose verhindern oder doch zumindest effizient behandeln zu können. Viele der mikrobiellen Infektionserreger haben gemeinsam, dass sie zur Krankheitsauslösung in eine Wirtszelle eindringen und sich dort vermehren müssen. Häufig wird sogar eine Fresszelle des Immunsystems infiziert, die eigentlich der Abwehr dient und die von den Pathogenen zum Lebensraum umprogrammiert wird. Dabei existiert das Pathogen in definierten membranumgebenen Räumen der Wirtszelle, den Zellkompartimenten. Die Erforschung dieser Kompartimente als Orte der Entscheidung zwischen Vermehrung oder Eliminierung des mikrobiellen Erregers steht im Mittelpunkt dieses Schwerpunktprogramms. Zentrale Fragestellungen sind: Wie sind die pathogenenthaltenden Kompartimente zusammengesetzt und welche physiologischen Bedingungen herrschen in ihnen? Welche pathogeneigenen und welche wirtsproduzierten Substanzen sind für die Einrichtung und Aufrechterhaltung dieser Kompartimente verantwortlich? Welche Substanzen des Erregers bzw. des Wirts werden auf welchem Weg aus dem Kompartiment heraus- oder in das Kompartiment hineintransportiert? Welche Wechselwirkungen gibt es mit anderen Kompartimenten der infizierten Zelle? Wie wird entschieden, welche Wirtszellvesikel mit einem pathogenenthaltenden Kompartiment interagieren und welche nicht? Wie schalten die Pathogene intrakompartimentelle Abwehrmechanismen des Wirts aus? In Deutschland gibt es eine hervorragende und traditionell vorwiegend biochemisch und genetisch ausgerichtete Mikrobiologie. Daneben hat sich eine starke Zellbiologie etabliert, die sowohl molekularbiologische Methoden als auch modernste bildgebende Verfahren benutzt, um zelluläre Vorgänge zu verstehen. Das Schwerpunktprogramm bringt diese bisher getrennten Disziplinen zur zellbiologischen Charakterisierung pathogenenthaltender Kompartimente zusammen. Dies wird zweifellos einen bleibenden Einfluss auf die Forschungslandschaft in diesen Bereichen haben und erlauben, eine internationale Vorreiterrolle in diesem Feld einzunehmen.
Teilprojekt:
In früheren Untersuchungen konnten wir Hsp40 Proteine (PfHsp40) identifizieren, die von P. falciparum synthetisiert und in die Wirtszelle exportiert werden. Im laufenden Projekt gelang uns die Identifizierung eines Hsp 70 Proteins (PfHsp70x), das ebenfalls exportiert wird und das ein Interaktionspartner der Hsp 40 Proteine fungieren könnte. Im Fortsetzungszeitraum möchten wir analysieren, ob diese beiden Proteine eine Rolle bei der Verteilung anderer Parasitenproteine in der infizierten Zelle haben. Als experimentelle Ansätze sind reverse Genetik und Komplementationsstudien beabsichtigt. Auch soll eine mögliche Interaktion des humanen Hsp 70 mit PfHsp40 untersucht werden. Sollte PfHsp70x eine für den Parasiten essentielle Funktion besitzen, wird das langfristige Ziel darin bestehen, diese Funktion durch Inhibitoren zu beeinträchtigen.
Coordinating organisation / Consortium Leader
- University of Bonn
Cooperation partners with funding
- The Francis Crick Institute
- Robert Koch Institute
- University of Würzburg
- Osnabrück University
- Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine