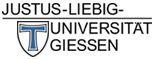Verbundprojekt
Convivial – Praxis oder Programm?
Geldgeber: Stiftung Convivial
Laufzeit: 2021-2023
URL: https://www.convivial.de/projekte/convivial-praxis-oder-programm
Ausführliche Beschreibung:
Die Beschreibung der Stiftung auf der Internetseite der Stiftung Convivial beginnt mit einer Frage: Warum Convivial? Ist „‚Convivial‘ ein einladender Name?“ heißt es dort, und die Antwort folgt sogleich: „er wirkt eher wie eine Schwelle, über die man ins Stolpern kommt“. In vier Symposien will das Projekt "Convivial?" mit Interessierten über diese Schwellennatur des Stiftungsnamens ins Gespräch kommen.
Stein des Anstoßes war für uns ein Manifest, das 2014 in einer ersten Fassung publiziert wurde und den Titel „Konvivialistisches Manifest“ trägt.1 In diesem Manifest wird eine konviviale Gesellschaft als ein letzter Wert angestrebt, dessen Erreichen im Lichte des Textes als planetarische Notwendigkeit dargestellt wird, so dass die AutorInnen pädagogische und selbst polizeiliche Maßnahmen für legitim erachten, um eine solche Gesellschaft global durchzusetzen. Der Abstand dieser Vision von jener „Art des Miteinanders“, die von der Stiftung gepflegt wird, und für die „offenbar ein Tisch, um den man sich versammeln kann, ein Krug Wein, den man gemeinsam leeren kann, und Brot, das man miteinander teilt, ziemlich unverzichtbare Utensilien sind“ erschien uns riesig. Zumal da auf dem Tisch noch eine Kerze brennt für jemand anderen, einen Fremden, einen Gast, vielleicht ein Freund, für jemanden, der unsere Gewohnheiten, Gewissheiten und Vorstellungen von zwingenden Notwendigkeiten ins Wanken bringen könnte. Denn diese Kerze ist eine „Mahnung, dass die Gemeinschaft nie geschlossen ist“, heißt es auf der Stiftungsseite.
Ausgangspunkt unseres Grübelns, das wir mit Ihnen und Euch fortführen wollen, ist ein Buch von Ivan Illich, das im Englischen den Titel „Tools for Conviviality“ trägt und im Deutschen „Selbstbegrenzung“ lautet.2 In diesem Buch werden wir herausgefordert, darüber ins Gespräch zu kommen, wie wir eine Distanz zu den „Dingen“ im weitesten Sinne – Werkzeuge, Institutionen, Systeme, Konzepte - finden und pflegen könnten, die es uns erlaubte, miteinander befreundet und in dieser Freundschaft frei zu sein.
In vier Symposion wollen wir diese Frage aufgreifen und den tödlichen Ernst klimapolitisch motivierter (Selbst-)steuerung mit der Frage nach einer freudigen, aber nüchternen asketischen Praxis konfrontieren, wie Illich sie in seinem Buch „Selbstbegrenzung“ aufgeworfen hatte.
Die Beschreibung der Stiftung auf der Internetseite der Stiftung Convivial beginnt mit einer Frage: Warum Convivial? Ist „‚Convivial‘ ein einladender Name?“ heißt es dort, und die Antwort folgt sogleich: „er wirkt eher wie eine Schwelle, über die man ins Stolpern kommt“. In vier Symposien will das Projekt "Convivial?" mit Interessierten über diese Schwellennatur des Stiftungsnamens ins Gespräch kommen.
Stein des Anstoßes war für uns ein Manifest, das 2014 in einer ersten Fassung publiziert wurde und den Titel „Konvivialistisches Manifest“ trägt.1 In diesem Manifest wird eine konviviale Gesellschaft als ein letzter Wert angestrebt, dessen Erreichen im Lichte des Textes als planetarische Notwendigkeit dargestellt wird, so dass die AutorInnen pädagogische und selbst polizeiliche Maßnahmen für legitim erachten, um eine solche Gesellschaft global durchzusetzen. Der Abstand dieser Vision von jener „Art des Miteinanders“, die von der Stiftung gepflegt wird, und für die „offenbar ein Tisch, um den man sich versammeln kann, ein Krug Wein, den man gemeinsam leeren kann, und Brot, das man miteinander teilt, ziemlich unverzichtbare Utensilien sind“ erschien uns riesig. Zumal da auf dem Tisch noch eine Kerze brennt für jemand anderen, einen Fremden, einen Gast, vielleicht ein Freund, für jemanden, der unsere Gewohnheiten, Gewissheiten und Vorstellungen von zwingenden Notwendigkeiten ins Wanken bringen könnte. Denn diese Kerze ist eine „Mahnung, dass die Gemeinschaft nie geschlossen ist“, heißt es auf der Stiftungsseite.
Ausgangspunkt unseres Grübelns, das wir mit Ihnen und Euch fortführen wollen, ist ein Buch von Ivan Illich, das im Englischen den Titel „Tools for Conviviality“ trägt und im Deutschen „Selbstbegrenzung“ lautet.2 In diesem Buch werden wir herausgefordert, darüber ins Gespräch zu kommen, wie wir eine Distanz zu den „Dingen“ im weitesten Sinne – Werkzeuge, Institutionen, Systeme, Konzepte - finden und pflegen könnten, die es uns erlaubte, miteinander befreundet und in dieser Freundschaft frei zu sein.
In vier Symposion wollen wir diese Frage aufgreifen und den tödlichen Ernst klimapolitisch motivierter (Selbst-)steuerung mit der Frage nach einer freudigen, aber nüchternen asketischen Praxis konfrontieren, wie Illich sie in seinem Buch „Selbstbegrenzung“ aufgeworfen hatte.
Koordinierende Einrichtung
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Kooperationspartner mit Förderung
- Justus-Liebig-Universität Gießen
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover