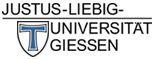Individual project
OpThis - Optimierung des Theorie-Praxis-Verhältnisses in den hochschulischen BA-Studiengängen
Funder: Federal Ministry of Research, Technology and Space, former: Federal Ministry of Education and Research
Period: 2011-2014
URI: https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=view&fkz=01NV1111
Detailed description:
Mittlerweile gibt es in Deutschland über 60 elementarpädagogische Studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten. Sie alle sind in der neuen BA/MA-Struktur entwickelt worden, die überwiegende Mehrzahl sind Bachelorstudiengänge. Der Bachelor ist ein akademischer Grad, der nach Abschluss eines ersten berufsqualifizierenden wissenschaftlichen Studiums von den Hochschulen vergeben wird. Mit dem Anspruch, in verkürzter Zeit einen berufsqualifizierenden Abschluss zu gestalten, wurden neue Herausforderungen an die Hochschulen gestellt, die nicht überall zu Zufriedenheit der Studierenden und des Arbeitsmarktes gelöst wurden. Einer der Kritikpunkte ist, dass die Studierenden zu wenig Praxiserfahrungen, Handlungskompetenzen und Theorie-Praxis-Reflexionen mitbringen. Doch laut europäischer Vereinbarung soll der Bachelor genau dieses sein: Ein erster Abschluss, der zur Aufnahme eines Berufes befähigt. Angesichts dieser Diskussion ist es insbesondere für die neuen elementarpädagogischen Studiengänge von höchster Priorität, die Frage der „Berufsqualifizierung“ im Hinblick auf das „Theorie-Praxis-Verhältnis“ in den Studiengängen zu klären. Im Hinblick auf die Ausgestaltung der frühpädagogischen Studiengänge formuliert auch Karsten in der Expertise „Rahmencurriculum: Elementarpädagogik“ folgenden Anspruch: „Die Praxiseinbindung in den Studiengängen sollte in Richtung gemeinsamen Forschens, gemeinsamen Erarbeitens, gemeinsamen Lernens und damit der Konkretisierung eigener Bildungsprozesse unter den Bedingungen von Praxis, ihrer Reflexion und Evaluation gestaltet werden“ (Kasten 2006, S. 5). Mit diesem Anspruch wird deutlich, dass das Theorie-Praxis-Verhältnis mehr als die Art der „Praktikumsgestaltung“ ist. Es geht dabei auch um die Praxisorientierung der Seminarinhalte, die tätigkeitsorientierte Umsetzung, die hochschuldidaktischen Grundlagen und die Optimierung von Transferprozessen.
In diesem Forschungsprojekt geht es daher um die Fragestellung, wie eine Optimierung des Theorie-Praxis-Verhältnisses in den hochschulischen Studiengängen für KindheitspädagogInnen stattfinden kann. Hierzu wird eine empirische Erhebung vorgenommen, die alle neuen elementarpädagogischen BA-Studiengänge hinsichtlich des Theorie-Praxis-Bezugs untersucht. Ziel ist es, ein aktuelles Bild des Theorie-Praxis-Verhältnisses in elementarpädagogischen Studiengängen zu beschreiben sowie spezifische Lösungsstrategien zur Realisation von Theorie-Praxis-Verknüpfungen aufzuzeigen.
Als Ergebnis wird ein differenzierter Überblick der Formen von Theorie-Praxis-Verknüpfungen in allen elementarpädagogischen BA-Studiengängen gegeben. Davon ausgehend werden besondere Umsetzungsformen von Theorie-Praxis-Verknüpfungen als „Best-Practice-Modelle“ beschrieben, um so Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Letzteres muss vor dem jeweiligen Studiengangskonzept modellhaft gezeigt werden. Die Einordnung dieser Modelle wird vor dem Hintergrund bestehender erziehungswissenschaftlicher Diskurse zum Theorie-Praxis-Verhältnis vorgenommen werden.
Mittlerweile gibt es in Deutschland über 60 elementarpädagogische Studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten. Sie alle sind in der neuen BA/MA-Struktur entwickelt worden, die überwiegende Mehrzahl sind Bachelorstudiengänge. Der Bachelor ist ein akademischer Grad, der nach Abschluss eines ersten berufsqualifizierenden wissenschaftlichen Studiums von den Hochschulen vergeben wird. Mit dem Anspruch, in verkürzter Zeit einen berufsqualifizierenden Abschluss zu gestalten, wurden neue Herausforderungen an die Hochschulen gestellt, die nicht überall zu Zufriedenheit der Studierenden und des Arbeitsmarktes gelöst wurden. Einer der Kritikpunkte ist, dass die Studierenden zu wenig Praxiserfahrungen, Handlungskompetenzen und Theorie-Praxis-Reflexionen mitbringen. Doch laut europäischer Vereinbarung soll der Bachelor genau dieses sein: Ein erster Abschluss, der zur Aufnahme eines Berufes befähigt. Angesichts dieser Diskussion ist es insbesondere für die neuen elementarpädagogischen Studiengänge von höchster Priorität, die Frage der „Berufsqualifizierung“ im Hinblick auf das „Theorie-Praxis-Verhältnis“ in den Studiengängen zu klären. Im Hinblick auf die Ausgestaltung der frühpädagogischen Studiengänge formuliert auch Karsten in der Expertise „Rahmencurriculum: Elementarpädagogik“ folgenden Anspruch: „Die Praxiseinbindung in den Studiengängen sollte in Richtung gemeinsamen Forschens, gemeinsamen Erarbeitens, gemeinsamen Lernens und damit der Konkretisierung eigener Bildungsprozesse unter den Bedingungen von Praxis, ihrer Reflexion und Evaluation gestaltet werden“ (Kasten 2006, S. 5). Mit diesem Anspruch wird deutlich, dass das Theorie-Praxis-Verhältnis mehr als die Art der „Praktikumsgestaltung“ ist. Es geht dabei auch um die Praxisorientierung der Seminarinhalte, die tätigkeitsorientierte Umsetzung, die hochschuldidaktischen Grundlagen und die Optimierung von Transferprozessen.
In diesem Forschungsprojekt geht es daher um die Fragestellung, wie eine Optimierung des Theorie-Praxis-Verhältnisses in den hochschulischen Studiengängen für KindheitspädagogInnen stattfinden kann. Hierzu wird eine empirische Erhebung vorgenommen, die alle neuen elementarpädagogischen BA-Studiengänge hinsichtlich des Theorie-Praxis-Bezugs untersucht. Ziel ist es, ein aktuelles Bild des Theorie-Praxis-Verhältnisses in elementarpädagogischen Studiengängen zu beschreiben sowie spezifische Lösungsstrategien zur Realisation von Theorie-Praxis-Verknüpfungen aufzuzeigen.
Als Ergebnis wird ein differenzierter Überblick der Formen von Theorie-Praxis-Verknüpfungen in allen elementarpädagogischen BA-Studiengängen gegeben. Davon ausgehend werden besondere Umsetzungsformen von Theorie-Praxis-Verknüpfungen als „Best-Practice-Modelle“ beschrieben, um so Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Letzteres muss vor dem jeweiligen Studiengangskonzept modellhaft gezeigt werden. Die Einordnung dieser Modelle wird vor dem Hintergrund bestehender erziehungswissenschaftlicher Diskurse zum Theorie-Praxis-Verhältnis vorgenommen werden.