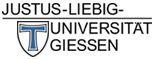Sammelbandbeitrag
Autorenliste: Bullerjahn, C
Erschienen in: Das Handbuch der Filmmusik : Geschichte – Ästhetik – Funktionalität
Herausgeberliste: Kloppenburg, J
Jahr der Veröffentlichung: 2012
Seiten: 25-85
ISBN: 978-3-89007-747-5
Abstract:
Versucht man die Bedeutung von Musik der Stummfilmzeit aus heutiger Sicht einzuschätzen, so könnte eine oberflächliche analytische Betrachtung beispielsweise in folgende Thesen münden: 1. Die Stummfilmzeit war eine relativ kurze Periode innerhalb der Filmgeschichte, die weitgehend ohne Folgen für die Musikbehandlung im Tonfilm blieb. 2. Der Stummfilm gewährte Musik eine nahezu grenzenlose Freiheit, musste Musik doch noch nicht in Konkurrenz mit Sprache und Geräusch treten. Beide Aussagen beinhalten in gleichem Maße Verkürzungen und Fehleinschätzungen: So lässt sich beispielsweise auf die erste Behauptung entgegnen, dass sich innerhalb der Stummfilmzeit die Filmmusiktechniken, d.h. Kompositionsstrategien entwickelten, die auch heute noch im Tonfilm in mehr oder weniger ausgeprägter Weise Verwendung finden. Zweifelsohne unterscheidet sich jedoch die späte Stumm- von der Tonfilmmusikpraxis durch die Live-Darbietung, das Prinzip des kontinuierlichen Spiels und die selektive Reproduktion von Bildton. Allerdings kann man der Stummfilmmusik keineswegs eine »grenzenlose Freiheit« attestieren, wie es die zweite Behauptung nahelegt: Da die Musikbegleitung zumeist aus dem Stegreif während einer Filmprojektion jedes Mal wieder neu entstand und nur in Ausnahmefällen als maßgeschneiderte und durchdachte Komposition bereits vorher vorlag, musste sich der musikalische Filmillustrator häufig auf die spontane Adaption konventionalisierter Standardstücke beschränken, um nicht die Filmhandlung völlig aus dem Auge zu verlieren. Ferner erlegte ihm gerade das Fehlen von Sprache und Geräusch einen neuen Zwang auf, denn der fotographische Realismus des Filmbilds verlangte nach einer wirklichkeitsnahen akustischen Ergänzung. Über weite Strecken bestand die Aufgabe des Kinomusikers deshalb darin, einen Ersatz zu liefern für Geräusche und Sprachmelodie, während man die konkreten sprachlichen Inhalte über Zwischentitel kommunizierte, die selbstverständlich als Stillstand der Handlung ebenfalls musikalisch zu überbrücken waren. Um solche Fehleinschätzungen im vorliegenden Beitrag zu vermeiden, sollen zunächst Argumente zusammengetragen werden, die eine Erklärung liefern für den grundsätzlichen Einsatz von Musik bereits bei den frühesten Stummfilmaufführungen. In diesem Zusammenhang wird es auch um die Funktionalität von Stummfilmmusik gehen. Die ebenfalls früh einsetzenden Bemühungen um eine Anhebung der Qualität von Kinomusik sind Gegenstand des folgenden Abschnitts. Betrachtet werden hierbei sowohl musikalische als auch technische Bestrebungen. Den Stummfilm-Originalkompositionen und ihren Vorläufern ist dagegen ein eigenes Kapitel gewidmet. Exemplarisch sollen hier einige Vertreter von Originalkompositionen vorgestellt werden. Im Anschluss befinden sich zwei Abhandlungen, die beide über die Stummfilmzeit hinaus weisen, nämlich zur Bedeutung der Kinoorgel und zu Charles Chaplins späten Stummfilmen. Überlegungen zu Rekonstruktionsversuchen und heutiger Stummfilmmusikpraxis beschließen den Beitrag.
Zitierstile
Harvard-Zitierstil: Bullerjahn, C. (2012) Musik zum Stummfilm : Von den ersten Anfängen einer Kinomusik zu heutigen Versuchen der Stummfilmillustration, in Kloppenburg, J. (ed.) Das Handbuch der Filmmusik : Geschichte – Ästhetik – Funktionalität. Laaber: Laaber Verlag, pp. 25-85
APA-Zitierstil: Bullerjahn, C. (2012). Musik zum Stummfilm : Von den ersten Anfängen einer Kinomusik zu heutigen Versuchen der Stummfilmillustration. In Kloppenburg, J. (Ed.), Das Handbuch der Filmmusik : Geschichte – Ästhetik – Funktionalität (pp. 25-85). Laaber Verlag.