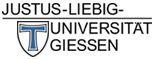Contribution in an anthology
Authors list: Bullerjahn, C
Appeared in: Musikermythen : Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen
Editor list: Bullerjahn, C; Löffler, W
Publication year: 2004
Pages: 313-351
ISBN: 978-3-487-12684-5
Title of series: Musik-Kultur-Wissenschaft
Number in series: 2
Abstract:
Carmen, eine der erfolgreichsten und beliebtesten Opern aller Zeiten, wurde in über zwanzig Sprachen übersetzt und schon bald nach der Uraufführung zahlreichen Bearbeitungen unterzogen. Viele namhafte Komponisten bekannten ihre Liebe zu dieser Oper, wenn sie sich oft auch nur in diesem Punkt einig waren. Carmen ist zugleich eines der frühesten Opernsujets und mit über neunzig Verfilmungen auch das meistverfilmte. Sie ist möglicherweise die erste ›realistische‹ Oper und vielleicht auch die filmischste. Eine zeitliche und räumliche Festlegung des Geschehens ist möglich. Ferner besitzt Carmen fast gar keine Arien im engeren Sinne, die einen Handlungsstillstand bedeuten würden. Nahezu alle Gesangsnummern sind an bestimmte Personen adressiert, also keine Monologe.
Die vermutlich erste Verfilmung stammt von der Filmpionierin Alice Guy. In der Folge gibt es noch häufiger Verfilmungen einzelner Stücke aus der Oper; die Einzelverfilmung von Opernarien scheint überhaupt sehr verbreitet gewesen zu sein. Einer besonderen Beliebtheit erfreut sich hierbei das Lied des Toreador. Der ohnehin häufig beklagte Mangel an geeigneten Filmstoffen führte zur Verfilmung jedweder bekannten literarischen Vorlage, oft leider unabhängig von deren Eignung. Der Versuch, das bürgerliche, zahlungskräftigere Publikums zu gewinnen, erklärt unter anderem die Masse der über vierzig schon während der Stummfilmzeit gedrehten Carmenadaptationen. Weitere Gründe sind die Praxis der Stummfilmuntermalung, die gerne auf kulturelles Repertoire zurückgriff, sowie die Verwandtschaft von Film und Oper als synthetische Künste.
Für Annäherungen über die Parodie gibt es Beispiele von Charles Chaplin und Raoul Walsh, als Cartoon, als Silhouettenfilm und als Operntravestie. Dass das Carmenthema bis in die jüngste Zeit seine Faszination und Aktualität keineswegs eingebüßt hat, belegt die Tatsache, dass 1989 eine in Deutschland produzierte Carmenverfilmung als Eisrevue und 1990 eine Fernsehproduktion zu Carmen negra, eine auf Georges Bizets Carmen beruhende Rockoper, erschienen sind. Ferner gibt es diverse Filme, die Ausschnitte aus der Oper mit einbeziehen und unzählige Filme verwandter Thematik. Zu guter Letzt war sich Carmen selbst für einen Videoclip oder Werbespot nicht zu schade. Auch eine Reinigungsmittelwerbung aus dem Jahre 1993 verwendet ein musikalisches Segment aus der Habanera sowie die entsprechende visuelle Ikonografie (enges, schwarzes, geschlitztes Kleid, langes Haar, Spanienassoziationen), möglicherweise dem neuen emanzipierten Bild der Frau entsprechend, die als Berufstätige ein schnell und einfach zu verwendendes, »autoaktives« Putzmittel benötigt.
Bei der Vielfalt an Ausdeutungen (z. T. handelt es sich eher um Ausbeutungen des Themas) stellt sich die Frage, welche Elemente den Korpus ›Carmen‹ überhaupt ausmachen. Es kristallisieren sich bei näherer Betrachtung sechs wesentliche Aspekte heraus, die den Mythos um Carmen begründen, nämlich das ›fremde‹ Spanien, die ritualisierte Tötung im Stierkampf, die ausgegrenzten, gleichwohl faszinierenden Zigeuner, der vom Schicksal vorbestimmte tragische Ablauf des Geschehens, die erotischen Verlockungen des Weiblichen und die (vergebliche) Suche nach Authentizität. Diese Aspekte sollen im Folgenden anhand ausgewählter Verfilmungen eingehender betrachtet werden.
Citation Styles
Harvard Citation style: Bullerjahn, C. (2004) Carmen – eine Projektionsfläche : Vergleichende Untersuchung von ausgewählten Verfilmungen, in Bullerjahn, C. and Löffler, W. (eds.) Musikermythen : Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen. Hildesheim: Olms, pp. 313-351
APA Citation style: Bullerjahn, C. (2004). Carmen – eine Projektionsfläche : Vergleichende Untersuchung von ausgewählten Verfilmungen. In Bullerjahn, C., & Löffler, W. (Eds.), Musikermythen : Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen (pp. 313-351). Olms.