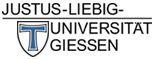Journal article
Authors list: Otte, A; Maul, P
Publication year: 2005
Pages: 151-182
Journal: Tuexenia
Volume number: 25
ISSN: 0722-494 X
URL: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30:3-448834
Publisher: Floristisch-Soziologische Arbeitsgemeinschaft e.V.
Seit 1890 wird die aus dem westlichen Nordamerika stammende Fabacee Lupinus polyphyllus Lindl. (Stauden-Lupine) in Deutschland beobachtet. Ihre großflächigsten Vorkommen in Deutschland finden sich derzeit in der Hohen Rhön im Gebiet Leitgraben/Elsgellen (407 ha: 1998 10,6 % Lupinus-Bedeckung). Dort werden fast alle Wiesen mit Auflagen des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms bewirtschaftet. Dies bedeutet, zeitlich gestaffelte Pflegetermine zwischen 10. Juli und 31. Oktober (Abschluss der Pflegearbeiten), die den Zeitraum der Samenbildung von Lupinus vollständig erschließen. Nachweisbar ist, dass dort, wo innerhalb der Vertragsnaturschutzflächen Heugewinnung die primäre Motivation für die Nutzung ist - dies bedeutet Nutzung zum frühest möglichen Zeitpunkt - keine Lupinus-Etablierung nachweisbar ist! Neben rechtzeitiger Mahd ist Beweidung mit (Rhön-)Schafen geeignet, die Ver- und Ausbreitung von Lupinus einzudämmen. Auch dafür gilt, dass sie vor der Samenreife (ab Anfang Juli) von Lupinus durchzuführen ist, da reife Lupinus-Samen durch Schafe endozooisch ausgebreitet werden. Vegetationsaufnahmen von Kleinseggenrieden (Caricetum fuscae), Borstgrasrasen (Polygalu-Nardetum) und Goldhaferwiesen (Geranio-Trisetetum), in denen Lupinus polyphyllus mit höheren Deckungsgraden (> 25 %) vorkommt, belegen, dass die niedrigwüchsigen Arten der Krautschicht zurückgedrängt werden. Parallel dazu nehmen die kräftige Horste ausbildenden Gräser Poa chaixii und Deschampsia cespitosa zu. Eine Trennartengruppe mit den Ruderalarten Cerastium glomeratum, Galium aparine agg., Galeopsis tetrahit, Cirsium arvense und Urtica dioica charakterisiert die Lupinus-Fazies. Die Konkurrenzkraft der Dominanzbestände mit Lupinus erklärt sich über die Biomasseverteilung in Form einer umgekehrten Pyramide, die über Bestandeshöhe (zwischen 70 und 110 cm) und dichte Belaubung stark beschattend auf tiefere Vegetationsschichten (< 30 cm) wirkt, so dass deren Arten ausdünnen, wenn sie nicht die ausreichende Plastizität im Höhenwachstum besitzen, um mit Lupinus mitzuhalten. Auch andere Dominanzbestände-aufbauende Arten wie Impatiens glandulifera, Heracleum mantegazzianum und Reynoutria ssp. besitzen diese Eigenschaft und können aufgrund ihrer Wuchshöhe sogar die Funktion einer fehlenden Strauchschicht übernehmen.
Abstract:
Citation Styles
Harvard Citation style: Otte, A. and Maul, P. (2005) Verbreitungsschwerpunkte und strukturelle Einnischung der Stauden-Lupine (Lupinus polyphyllus Lindl.) in Bergwiesen der Rhön, Tuexenia, 25, pp. 151-182. http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30:3-448834
APA Citation style: Otte, A., & Maul, P. (2005). Verbreitungsschwerpunkte und strukturelle Einnischung der Stauden-Lupine (Lupinus polyphyllus Lindl.) in Bergwiesen der Rhön. Tuexenia. 25, 151-182. http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30:3-448834