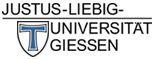Journalartikel
Autorenliste: Otte, A
Jahr der Veröffentlichung: 1990
Seiten: 43-92
Zeitschrift: Phytocoenologia
Bandnummer: 19
Heftnummer: 1
ISSN: 0340-269X
DOI Link: https://doi.org/10.1127/phyto/19/1990/43
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-62968
Verlag: Schweizerbart Science Publishers
Von 1985 bis 1988 wurde auf drei Ackerschlägen nördlich von Freising (Oberbayern, 490 m üNN) die Entwicklung von Beständen des Alchemillo arvensis-Matricarietum chamomillae, montane Galeopsis tetrahit-Form; Tx. 37 em. Oberd. 58; Oberdorfer 1983) nach dem Aussetzen von Unkrautregulierungsmaßnahmen beobachtet. Die Vegetationsentwicklung wurde in vollständigen phänologischen Diagrammen dokumentiert (Dierschke 1972); außerdem wurden Bodenparameter (Mineralstickstoffversorgung und pH-Wert-Entwicklung während der vier Anbauperioden; Bodenkenngrößen: Korngrößenverteilung, organischer Kohlenstoffgehalt, Gesamt-Phosphat- und Kaliumvorräte) und der Samenvorrat/m2 30 cm Bodentiefe zu Versuchsbeginn bestimmt. Durch den Vergleich mit einer Untersuchung von 1951 (Schramm 1954) konnten Veränderungen im Artenspektrum der Probeflächen seit der Erstaufnahme aufgezeigt werden. Seit 1951 konnten 23 Arten nicht mehr nachgewiesen werden, allerdings sind 36 Arten neu dazugekommen. Die rückläufigen Arten konnen durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet werden: Niedere Temperaturansprüche bei der Keimung, relativ hohes Wärmebedürfnis während der Vegetationszeit und Bevorzugung basischer Böden; die neu dazugekommenen Arten sind durch höheres Nährstoffbedürfnis, höhere Ansprüche an die Bodenfeuchtigkeit und geringere Ansprüche gegenüber dem Säuregrad des Bodens ausgezeichnet. Auf das Aussetzen von Regulierungsmaßnahmen (Herbizide oder Striegeln; 1985-1988) ohne Reduzierung der Düngung reagieren Ackerwildkräuter mit einer Verlängerung der samenbildenden Phase (= höhere Samenproduktion) und/oder mit dem Anstieg ihrer Artmächtigkeiten oder ohne derzeit erkennbare Veränderungen in ihrem Populationsaufbau. Am stärksten von den ausgesetzten Regulierungsmaßnahmen haben Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Veronica persica, Galium aparine und Spergula arvensis profitiert, in geringerem Ausmaß Veronica polita. Bei den genannten Arten verlängerte sich die Phase der Samenbildung, und die Artmächtigkeit war nach vier Beobachtungsjahren deutlich angestiegen. Nur eine Verlängerung in der Samenphase war bei Veronica arvensis, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Raphanus raphanistrum, Arabidopsis thaliana, Anagallis arvensis und Fallopia convolvulus zu verzeichnen. Bei diesen Arten (Ausnahme Chenopodium album) war die Samenbank im Boden zu Versuchsbeginn gering oder nicht nachweisbar, so daß es länger als vier Anbauperioden dauerte, bis der Samenvorrat soweit angereichert war, daß er sich auch in einem Anstieg der Artmächtigkeit (= Populationsdichte) bemerkbar machte. Eine deutliche Zunahme der Artmächtigkeit - ohne Verlängerung der samenbildenden Phase wurde bei Chenopodium ficifolium, Atriplex patula, Sonchus asper, Chenopodium polyspermum, Lamium amplexicaule, Erophila verna und Veronica hederifolia registriert. Keine Veränderungen in den Artmächtigkeiten wurden u. a. bei den relativ kleinwüchsigen Krumenfeuchte- und Frischezeigern Sagina procumbens, Juncus bufonius, Polygonum tomentosum, Plantago intermedia, Matricaria matricaroides und den Getreidearten Tripleurospermum inodorum, Apera spica-venti, Viola arvensis, Anthemis arvensis, Myosotis arvensis und Matricaria chamomilla festgestellt, obwohl deren Samenbank im Boden (sehr) hoch ist. Ihre Entwicklung wurde durch dichte Kulturpflanzen-Bestände und die wüchsigen Nährstoffzeiger (s.o.) unterdrückt. Bei der Auswertung der phänologischen Diagramme wurde festgestellt, daß sich bei Ackerwildkräutern eine neue Strategie im Aufgangsverhalten durchsetzt (bzw. durchgesetzt hat). Im Vergleich zu Untersuchungen, die Lauer (1953) zum Keimverhalten von Ackerwildkräutern durchgeführt hat (an Saatgut an der Umgebung von Freising), zeigt es sich, daß die Variabilität vieler Arten in ihren Aufgangsphasen (-zeiten) heute größer ist als früher. D.h., daß das Überleben vieler Arten heute von der Fähigkeit abhängt, mehrmals nach Regulierungsmaßnahmen wieder aufzugehen. Besonders deutlich zeigt sich diese Anpassung bei Chenopodium ficifolium; die Art wurde gemeinsam mit Chenopodium rubrum von Lauer als Art mit »höchsten Ansprüchen an die Temperatur bei der Keimung" (zwischen 30 und 40 °C) eingestuft und galt 1953 in der Gegend von Freising als selten. Heute läuft Chenopodium ficifolium gemeinsam mit Chenopodium album und Atriplex patula ab April auf und ist eine der häufigsten Arten in den Mais-betonten Fruchtfolgen des südlichen Donau-Isar-Hügellandes.
Abstract:
Zitierstile
Harvard-Zitierstil: Otte, A. (1990) Die Entwicklung von Ackerwildkraut-Gesellschaften auf Böden mit guter Ertragsfähigkeit nach dem Aussetzen von Unkrautregulierungsmaßnahmen, Phytocoenologia, 19(1), pp. 43-92. https://doi.org/10.1127/phyto/19/1990/43
APA-Zitierstil: Otte, A. (1990). Die Entwicklung von Ackerwildkraut-Gesellschaften auf Böden mit guter Ertragsfähigkeit nach dem Aussetzen von Unkrautregulierungsmaßnahmen. Phytocoenologia. 19(1), 43-92. https://doi.org/10.1127/phyto/19/1990/43