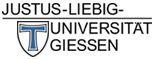Journal article
Authors list: Eder, K
Publication year: 2009
Pages: 262-267
Journal: Pharmazie in unserer Zeit
Volume number: 38
Issue number: 3
ISSN: 0048-3664
DOI Link: https://doi.org/10.1002/pauz.200800316
Publisher: Wiley / Wiley-VCH Verlag: No OnlineOpen
Magnesium ist nach dem Kalium das mengenmäßig zweithäufigste intrazelluläre mineralische Element in unserem Körper. Aufgrund seiner vielfältigen Funktionen im Körper führt eine unzureichende Versorgung an Magnesium zu einem breiten Spektrum an Mangelsymptomen. Der Magnesium‐Haushalt des Körpers wird durch Resorption aus dem Darm, Ausscheidung über den Stuhl und den Urin sowie Einlagerung oder Freisetzung in das bzw. aus dem Skelett reguliert. Die Resorption von Magnesium erfolgt über den kompletten Darm durch zwei verschiedene Prozesse, zum einen Carrier‐vermittelt, zum anderen parazellulär durch passive Diffusion. Die Resorptionsrate aus der Nahrung liegt normalerweise bei 35 bis 55 %. Bei fettreicher Nahrung oder der Aufnahme verschiedener Nahrungsinhaltsstoffe, die die Magnesium‐Resorption hemmen wie Phosphat, Phytat oder Oxalat, kann sie aber deutlich reduziert sein. Für die Wirksamkeit von Magnesium‐Präparaten spielt die intestinale Bioverfügbarkeit des Magnesiums eine entscheidende Rolle. Organische Magnesium‐Verbindungen wie das Citrat, Aspartat, Aspartat‐hydrochlorid, Gluconat oder Aminosäurekomplexe haben eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit als anorganische Magnesium‐Salze wie das Carbonat, Oxid oder Sulfat (mit Ausnahme von Chlorid). Organische Magnesium‐Verbindungen sind als Supplemente daher den weniger gut resorbierbaren anorganischen Verbindungen wie Magnesiumoxid oder ‐carbonat vorzuziehen.
Abstract:
Citation Styles
Harvard Citation style: Eder, K. (2009) Magnesium‐Verbindungen. Aufnahme, Funktionen und therapeutische Aspekte, Pharmazie in unserer Zeit, 38(3), pp. 262-267. https://doi.org/10.1002/pauz.200800316
APA Citation style: Eder, K. (2009). Magnesium‐Verbindungen. Aufnahme, Funktionen und therapeutische Aspekte. Pharmazie in unserer Zeit. 38(3), 262-267. https://doi.org/10.1002/pauz.200800316