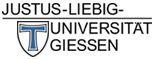Journal article
Authors list: Latki, T; Rebelo, NG; Failing, K; Fey, K
Publication year: 2017
Pages: 72-80
Journal: Pferdeheilkunde
Volume number: 33
Issue number: 1
ISSN: 0177-7726
Open access status: Bronze
DOI Link: https://doi.org/10.21836/PEM20170110
Publisher: Hippiatrik
Ziel dieser prospektiven, verblindeten, randomisierten und kontrollierten Studie war es, durch die zeitgleiche Verabreichung von Kaliumchlorid bei der intragastralen Abführtherapie mit wasserfreiem Natriumsulfat die bekannterweise auftretenden Absenkungen der Blutkaliumspiegel zu verhindern. In die Studie gingen 33 Patienten mit gering- bis mittelgradig eingestuften Obstipationen des Dickdarmes ein. Alle Pferde erhielten wasserfreies Natriumsulfat in einer Dosierung von 0,44 g/kg KGW, da somit eine Natriumsulfatmenge verabreicht wird, die in 1g/kg KGW Glaubersalz enthalten wäre. Nach Diagnose und Erfüllung der Ein- und Ausschlusskriterien wurden die Patienten randomisiert einer von drei Gruppen zugeordnet: Die Kontrollgruppe K0 erhielt kein Kalium, während den Therapiegruppen Kaliumchlorid (E 508), in einer Dosierung von entweder 25 mg/kg KGW (K25) oder 50 mg/kg KGW (K50) verabreicht wurde. Alle Salze wurden gemeinsam in 1,225 Liter/100 kg KGW Wasser gelöst und per Nasenschlundsonde verabreicht. Klinische Untersuchungen und Blutkontrollen wurden alle zwei Stunden über die nächsten 24 Stunden durchgeführt, ohne dass der Untersucher Kenntnis davon hatte, in welcher Behandlungsgruppe sich der Patient befand. Bei den Probanden wurden mittels rektaler Untersuchung 15 Verstopfungen im Colonascendens, 12 Caecumobstipationen sowie 6 Obstipationen im Colon und Caecum diagnostiziert. Alle Pferde konnten geheilt entlassen werden. Eine Stute verblieb nur bis 18 Stunden nach der Abführtherapie in der Studie, da sie zu diesem Zeitpunkt Koliksymptome zeigte und eine verstärkte Colonobstipation aufwies. Daher wurde sie mit Analgetika und intravenöser Flüssigkeitszufuhr behandelt. Bei zwei Patienten mit Caecumobstipation und einem mit einer Verstopfung im Colon hatte sich das Obstipat nach Studienende nicht genügend gelöst. Bei diesen drei Probanden wurde die Abführtherapie komplikationslos wiederholt, was zum Therapieerfolg führte. Hinsichtlich der Lösung der Obstipationen ergaben sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Auch für die klinischen Parameter wie Herz- und Atemfrequenz sowie Darmperistaltik ergaben sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Ein schwach signifikanter Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen (p < 0,04) wurde für die Kaliumkonzentration ermittelt. Allerdings wiesen alle drei Gruppen weiterhin Abfälle in den Blutkaliumkonzentrationen innerhalb der ersten 6 – 8 Stunden nach der Natriumsulfatgabe auf, wobei die Werte der mit 50 mg/kg KCl substituierten Gruppe rascher wieder in ihre Ausgangsbereiche zurückzukehren schienen. Ebenso erwiesen sich die Unterschiede der pH-Werte zwischen den Gruppen als statistisch signifikant (p < 0,02). Hier zeigte K0 die stärkste Alkalose 6 Stunden nach der Na2 SO4 -Gabe und auch die pH-Werte schienen KCl-dosisabhängig rascher wieder ihre Ausgangsbereiche zu erreichen. Die metabolische Alkalose ist am Ehesten durch die bei der Abführtherapie zugeführten Natriumionen zu erklären, da Natrium als stark basisches Kation wirkt. Der zeitgleich zur Alkalose beobachtete Abfall des Kaliums entstand wahrscheinlich, weil Protonen im Austausch mit Kaliumionen in den Intrazellularraum verschoben wurden. Ebenfalls zeitlich parallel zur Alkalose war ein Abfall der Werte des ionisierten Kalziums festzustellen. Dies mag mit dem Freiwerden von zuvor durch H+-Ionen besetzte Bindungsstellen an Bluteiweißen zusammenhängen. Die labordiagnostisch festzustellenden Veränderungen der Elektrolyte und des Säure-Basen-Haushaltes wurden als eher geringgradig eingestuft, hatten dementsprechend keine klinisch wahrnehmbaren Konsequenzen und waren ganz überwiegend am Studienende nach 24 Stunden ohne therapeutische Maßnahmen wieder ausgeglichen. Trotz der Zugabe von Kaliumchlorid kam es 6 – 8 Stunden nach Abführtherapie mit Natriumsulfat zur Absenkung der Kalium- und Kalzium-Blutspiegel bei Anstieg der Natriumkonzentrationen, pH- und Bikarbonat-Werte. Die zusätzliche Gabe von Kaliumchlorid schien dosisabhängig diese labordiagnostisch erkennbaren Veränderungen zu verringern. Daher empfehlen wir einen Kaliumzusatz von mindestens 50 mg/kg KGW bei der Abführtherapie mit Natriumsulfat. Ob die Zugabe von Kalziumchlorid (E 509) weitere Verbesserungen erbringt müssten künftige Studien zeigen. Insgesamt liegen die Störungen im Elektrolyt- bzw. Säure-Basen-Haushalt nach Abführtherapie primärer, gering- bis mittelgradiger Obstipationen des Dickdarmes mit Natriumsulfat nach Meinung der Autoren in einem Größenbereich, der deutlich aufwändigere Therapieverfahren wie die stündliche Flüssigkeitszufuhr per Sonde bzw. intravenöse Infusionen nicht zu rechtfertigen vermag.
Abstract:
Citation Styles
Harvard Citation style: Latki, T., Rebelo, N., Failing, K. and Fey, K. (2017) Kaliumchlorid vermindert Elektrolytverschiebungen nach Gabe von Natriumsulfat bei primären Colon- und Caecumobstipationen, Pferdeheilkunde, 33(1), pp. 72-80. https://doi.org/10.21836/PEM20170110
APA Citation style: Latki, T., Rebelo, N., Failing, K., & Fey, K. (2017). Kaliumchlorid vermindert Elektrolytverschiebungen nach Gabe von Natriumsulfat bei primären Colon- und Caecumobstipationen. Pferdeheilkunde. 33(1), 72-80. https://doi.org/10.21836/PEM20170110